
"Crowdsourcing" und "Selbstbedienung"
Notizen über das Internet als Rationalisierungsmaschine
(Dezember 2007)
An das weltweite Computernetz heften sich Phantasien aller Art. Es steht sinnbildlich für eine neue Ökonomie, in der Gewinne scheinbar automatisch sprudeln, bei Innenministern gilt es als Tummelplatz von Pädophilen und Terroristen und manchen Linken gar als Vorschein des Kommunismus, als Sphäre, in der die freie Assoziation der Produzenten bereits verwirklicht sei. Im folgenden wird eine andere Perspektive gewählt und das Internet als Mittel zur Rationalisierung betrachtet.
Erfolgsgeschichte Selbstbedienung
Bis zum Jahr 2003 hatte die schwedische Möbelfirma Ikea ungefähr 30 Millionen Mal das beliebte Regal "Billy" verkauft. 30 Millionen Kunden haben sich für das praktische Möbel entschieden, die etwas unhandlichen Pakete nach Hause gebracht und dort die Einzelteile zusammengebaut. Rechnet man nun (wie es die Soziologen Kerstin Rieder und Günther Voß in ihrem Buch "Der arbeitende Kunde" tun) für die Montage eine knappe halbe Stunde, legt einen fiktiven Stundenlohn von 5 Euro zugrunde und multipliziert, erhält man ein beeindruckendes Ergebnis: 75 Millionen Euro Arbeitslohn wären fällig, könnte der Konzern nicht umsonst auf die Arbeit der Kunden zugreifen.
Ein unrealistisches Beispiel, natürlich. Schließlich beruht die Allgegenwart von "Billy", "Hästveda" und all der anderen Ikea–Möbel nicht zuletzt auf ihrem schwer zu unterbietenden Preis. Die Käufer entscheiden sich für das Regal im Eigenbau, weil sie den Wert der Montage nicht bezahlen wollen oder können. Dieses Geschäftsmodell ist nicht neu. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitet sich "Selbstbedienung" unaufhaltsam. Heute aber ermöglicht das Internet einen qualitativen Sprung: Die "Arbeit der Kunden" wird nun auf allen Stufen der Produktion eingeplant und verwertet.
Wer seine Waren selbst auswählt, braucht Informationen. Das heutige Rationalisierungsniveau der Dienstleistungen wurde erst möglich, nachdem sich der Zugang zum Internet massenhaft verbreitet hatte. Es ist das wirksamste Mittel zur Standardisierung und Automatisierung und so gesehen vor allem eine riesige Rationalisierungsmaschine. Immer mehr wird zum Standard, was früher noch ein Sonderangebot war. "Online–Banking" hat längst alles Exotische verloren: Warum in der Schlange darauf warten, von einem Bankangestellten bedient zu werden, wenn sich die Transaktionen auch von Schreibtisch aus erledigen lassen? Und je weiter die Personaldecke ausgedünnt wird, desto attraktiver wird die Selbstbedienung im Netz.
Auch öffentliche Einrichtungen versuchen mittlerweile, ihre Arbeit durch sogenanntes E–Government zu verbilligen. Die beiden Autoren Rieder und Voß weisen auf den mutmaßlich nächsten Schritt der Entwicklung hin: „Es ist absehbar, dass im Zuge der Reform des Gesundheitssystems demnächst auf Erkrankte von ihnen aktiv zu steuernde Fern- und Selbstdiagnosen (über Internet oder Call Center) und im nächsten Schritt die Umsetzung von Behandlungsanweisungen zur zumindest partiellen Selbsttherapie zukommen werden."
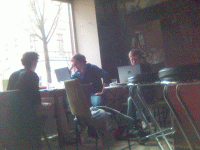
Von der "systemischen Rationalisierung" zum "Crowdsourcing"
Rationalisierung bedeutet, den Arbeitsablauf organisatorisch zu straffen oder ihn zu automatisieren, um mit dem Einsatz gleicher Mittel die Produktion zu steigern. Selbstbedienung wiederum erlaubt den Unternehmen, Lohnkosten einzusparen, in dem manche Arbeitsschritte auf die Kunden verlagert werden. Industriesoziologie und Betriebswirtschaftslehre sprechen von "systemischer Rationalisierung": Unternehmen suchen nicht mehr nur innerhalb des Betriebs nach Einsparmöglichkeiten, sondern auch außerhalb. Jeder Aspekt der Herstellung und Distribution kommt auf den Prüfstand: Warum ausliefern, wenn die Kunden die Produkte selbst abholen? Warum beraten, wenn sie sich selbst informieren?
Das Internet ermöglicht aber noch mehr, nämlich "interaktive Wertschöpfung" oder "peer production" (etwa: "gleichrangige Produktion"). Unternehmen greifen dabei auf die freiwillige Zuarbeit von Internetnutzern zurück, die unentgeltlich oder für nur geringe Beträge arbeiten. Wem dieser Zugriff gelingt, kann die Konkurrenz aus dem Feld schlagen und gewaltige Profite machen – wie das Beispiel der US–amerikanischen Bildagentur iStockphoto anschaulich zeigt. Diese "Community–Website" wurde im Jahr 200 gegründet. Auf ihr konnten Fotografinnen ihre digitalisierten Bilder präsentieren, zunächst kostenlos, später gegen einen kleinen Betrag. Nach einer Weile begannen Zeitschriften und Magazine, die Sammlung als Bildarchiv zu nutzen. Bei Abdruck zahlen sie Fotografen einen Bruchteil des üblichen Preises. 2006 kaufte die Agentur Getty Images das Unternehmen für 50 Millionen Dollar.
Oder Mechanical Turk, ein Angebot des Internethändlers Amazon: Hier suchen und finden Unternehmen wie Casting Words Online–Tagelöhner, denen sie eine Art digitalen Stücklohn zahlen. Diese Firma verkauft Transkripte von Sprachaufnahmen. Für das Verschriftlichen von Minute Sprachaufnahme gibt es ganze 19 US–Cent. Weil die Qualitätskontrolle durch qualifizierte Arbeitskräfte die Kosten wieder anheben würde, nutzt man zur Korrektur dieselbe Strategie. Internetnutzer erhalten 9 Cent für ihre Beurteilung, ob die schriftliche Version korrekt ist oder nicht. Die Masse arbeitet nicht nur selbständig, sie kontrolliert sich auch selbst.
Das ist nicht nur eine Obskurität. Mehr als 100 000 Menschen aus über 100 Ländern bearbeiten heute Aufträge, die sie bei Mechanical Turk gefunden haben. (Die genauen Zahlen behält die Firma lieber für sich.) Das Geschäftskonzept zahlreicher Unternehmen würde ohne solche Strategien gar nicht funktionieren. Häufig wird im Netz gearbeitet, ohne dass es die Internetnutzer überhaupt bemerken. Sie versehen nebenbei Bilder mit Schlagworten, bewerten Texte, diskutieren die beste Übersetzung und produzieren Information, die Firmen profitabel nutzen. Oder sie entwickeln kollektiv und mit großem Eifer Open Source–Software, mit deren Hilfe später Unternehmen eine Menge Geld verdienen.

Verwaschene Begriffe, verschleiernde Rhetorik
Vor einem Jahr erfand Jeff Howe, ein Redakteur des US–amerikanischen Magazins Wired, den passenden Namen für diese Unternehmensstrategie: "Crowdsourcing", zusammengesetzt aus den englischen Wörtern für Menge und Auslagerung. "Im letzten Jahrzehnt oder so haben die Firmen im Ausland, in China und Indien nach billiger Arbeit gesucht“, schrieb Howe. „Aber nun ist es egal, wo sich die Arbeitenden aufhalten – um die Ecke oder in Indonesien, solange sie mit dem Netzwerk verbunden sind." Stilbildend war dieser Text auch insofern, als Howe den Vorgang mit einem quasi–technischen Vokabular beschrieb: "Genauso wie manche Forschungsprojekte die Rechnerkapazitäten von vielen tausend einzelnen Heimcomputern anzapfen, nutzen die Arbeitsnetzwerke die ungenutzte Prozessoren von Millionen menschlicher Hirne." Immer wieder wird in den Texten über Crowdsourcing der Produktionsprozess als eine einzige gewaltige Maschine dargestellt und die Menschen gleichsam als Roboter, deren Funktionieren einfach vorausgesetzt scheint.
So nennt Amazon die menschliche Verstehensleistung bei Mechanical Turk "künstlich künstliche Intelligenz" oder auch "Dinge, die Menschen besser können als Computer". Den Namen borgte man sich von dem historischen vermeintlichen Schachautomaten "Der Türke", mit dem Wolfgang von Kempelen im späten 18. Jahrhundert das gebildete Europa verblüffte. Scheinbar konnte diese Maschine Schach spielen; in Wirklichkeit verbarg sich in ihr ein kleinwüchsiger Schachexperte. Eine passende Wahl: Was vermeintlich reibungslos von Maschinen erledigt wird, wird in Wirklichkeit von menschlicher Arbeitskraft angetrieben. Viele Crowdsourcing–Firmen haben ein eigenes Vokabular entwickelt. Bei der Internet–Vermittlungsagentur InnoCentive beispielsweise veranstalten Unternehmen Wettbewerbe, in denen sie ihre Probleme in der Produktentwicklung ausschreiben. Kommt die vorgeschlagene Problemlösung zum Einsatz zahlt sie zwischen 10 000 und 100 000 Dollar. Statt von "Auftraggebern" und Forschern spricht man hier lieber von "Suchern" und "Lösern". Bei Mechanical Turk wiederum heißen Arbeitgeber "Anfrager", statt Lohn zahlen sie eine "Belohnung".
Für meisten, die hier bestimmte Aufgaben übernehmen, ist der Verdienst allerdings zweitrangig – schließlich ließe sich von den gezahlten Beträgen auch gar nicht leben. Es sind gelangweilte Schüler oder Angestellte, die so am Arbeitsplatz die Büroroutine bekämpfen. Sie suchen einen Zeitvertreib, die Herausforderung an ihre Schnelligkeit, Kontakt mit anderen und Anerkennung. Die Unternehmen kommen diesen Bedürfnissen mit ihren Benutzeroberflächen entgegen: Die Arbeit wird als Wettbewerb verkleidet und in Gemeinschaften organisiert.

Gehört die Zukunft den Netzwerkunternehmen?
Crowdsourcing wie bei Mechanical Turk ist ein extremes Beispiel. Aber immer mehr Unternehmen kalkulieren die unbezahlte Arbeit der Massen mit ein. Das betrifft nicht nur Internet-Angebote. Gerade bei der Produktentwicklung nutzen auch Industriebetriebe die betriebsfremden Potentiale, so zum Beispiel der Autohersteller BMW. "Massenkooperation ändert alles" behaupten deshalb die beiden Unternehmensberater Don Tapscott und Anthony Williams. In ihrem Buch "Wikinomics" (2007) argumentieren sie, dass der Erfolg der Internetenzyklopädie Wikipedia, Internetforen, Weblogs, Second Life und kostenloser Software "einen grundlegenden ökonomischen Wandel" anzeigte. Von der "kooperativen Anarchie" im Netz könnten Unternehmen profitieren. Ja, laut Tapscott und Williams müssen sie es sogar, denn die verschärfte Konkurrenz lasse den Konzernen keine andere Wahl, als alle Einsparmöglichkeiten zu nutzen. Die Rationalisierungsstrategie Crowdsourcing wird von der Internationalisierung des Wettbewerbs angetrieben.
Wer in Zukunft die eigene Firma strikt nach außen abgrenze, so Tapscott und Williams, habe keine Chance, in der Konkurrenz zu bestehen. Statt dem veralteten hierarchischen Unternehmen gehöre die Zukunft der "Community aus Kunden, Nutzern, Herstellern, Lieferanten, Händlern und anderen Quellen innovativen Wissens", produktiven Netzwerken, deren Ränder gleichsam diffus auslappen.
Um diese Entgrenzung zu erklären, greifen Tapscott und Williams auf die Arbeiten des britischen Wirtschaftswissenschaftler Ronald Coase (geb. 1910) zurück. Coase veröffentlichte 1937 seinen einflussreichen Aufsatz "The Nature of the Firm", mit dem er die Größe beziehungsweise überhaupt die Daseinsberechtigung von kapitalistischen Unternehmen zu erklären versuchte. Warum, so ungefähr lautete seine Ausgangsfrage, beschäftigt etwa ein Nudelhersteller auch Wissenschaftler, die den optimalen Teig erforschen, Sekretärinnen, Reinigungskräfte und eine Werbeabteilung? Warum lagert er diese Funktionen nicht einfach aus und kauft sie auf dem Markt ein, der doch nach neoklassischer Ansicht die günstigsten Wissenschaftler, Sekretärinnen, Reinigungskräfte und Werbeagenturen bereitstellt? Coases Antwort beruht auf der Existenz von "Transaktionskosten", jenen Ausgaben, die dem Unternehmen durch die Benutzung des Marktes entstehen. Der Nudelhersteller muss schließlich erst einmal herausfinden, welche die günstigste Werbeagentur ist, die Verhandlung führen, sicherstellen, dass der Vertrag eingehalten wird, usw. All das kostet Geld, deshalb wird er in vielen Fällen die genannten Arbeitskräfte lieber selbst einstellen. Tapscott und Williams argumentieren nun, dass im Internet viele Transaktionskosten gar nicht entstehen oder zumindest gegen Null sinken lassen: "Alles hängt an den sinkenden Kosten der Kooperation."
Aus diesem Grund sei die Zeit der Großkonzerne nun vorbei, denn das Netz mache den fiktiven vollkommenen Markt, in dem alle Akteure alles wissen, zur Wirklichkeit. Die tatsächliche Entwicklung spricht eine andere Sprache. Manche Plattformen und Internetdienste wie Emailprovider oder Suchmaschinen sind zu international tätigen Konzernen aufgestiegen. Die Masse der Inhalte wiederum wird nach wie vor von wenigen Medienkonzernen kontrolliert, die oft mehrer Produktionsstufen integrieren. Die Erfolgsgeschichten in "Wikinomics" dagegen handeln von Vermittlungsagenturen, sogenannten "Matchmakern" wie iStockphoto, InnoCentive oder Mechanical Turk. Sie machen mit Transaktionsgewinnen gewaltige Profite, setzen aber nebenbei die unter Druck, die von ihrem Beruf leben müssen: Übersetzer, Wissenschaftler, Photographen, Demographen und so weiter. Hinter Coases "Transaktionskonsten" verbergen sich schlicht Lohnkosten, die durch das Internet gegen Null tendieren, sofern es eine umfassende Dequalifizierung und Konkurrenz ermöglicht.
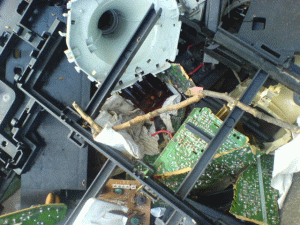
Strategischer Umgang mit "geistigem Eigentum"
"Das kollektive Wissen, die kollektiven Fähigkeiten und Ressourcen, die in dem breiten horizontalen Netzwerk schlummern, können aktiviert werden", schreiben Tapscott und Wiliams. Das bedingt aber einen neuen flexiblen Umgang mit dem "geistigen Eigentum", also Urheberrechten, Marken und Patenten des Unternehmens.
Um die künftige Ausgestaltung des "geistigen Eigentums" kämpfen bekanntlich die unterschiedlichsten Akteure, unter anderem: Medienkonzerne, Künstler, Internetservice–Provider (ISP), Verwertungsgesellschaften, Verlage und Konsumenten. Die Kritik, die linke Akademiker und Netzaktivisten bisher entwickelt haben, begreift das Netz in erster Linie als Vervielfältigungsmaschine für Musik und Filme und als ein Mittel für deren Verteilung. Sie propagiert den kostenlosen Tausch von Filmen und Medien und Open Source (kooperative Software, die alle Nutzer weiterentwickeln können). Sie richtet sich aber nicht gegen das Privateigentum an Produktionsmitteln (die heute ebenso "geistig" wie "materiell" sind - und es wahrscheinlich auch immer schon waren), sondern kritisiert die Profitinteressen, die das "geistige Eigentum" künstlich verknappen. Aber Eigentum ist bekanntlich kein Rechtstitel, der Menschen individuell zugesprochen oder aberkannt wird, sondern ein Verhältnis zwischen ihnen, also ein gesellschaftliches Verhältnis. Kurz: die gängige linke Kritik ignoriert das Internet als Produktionsmittel.
Ganz anders Tapscott und Williams. Auch sie wenden sich ausdrücklich gegen "Exzesse" bei der kommerziellen Ausbeutung von Patenten und Urheberrechten und plädieren vehement für Open Source. Um die Kreativität und Leistungsfähigkeit der Massen anzuzapfen, müssten die Unternehmen sich "öffnen", d.h. ihr Produktionswissen und ihre Betriebsgeheimnisse veröffentlichen. Das ist konsequent: Schließlich wollen die Unternehmensberater eine möglichst umfassende Zirkulation und möglichst viel Kooperation. Was "geistiges Eigentum" genannt wird, ist das tägliche Handwerkszeug im Netz – wer die Massen für sich arbeiten lassen will, muss ihnen erlauben, die Werkzeuge und Rohstoffe anzufassen.
Die Autoren raten Unternehmern zu einem strategischem Vorgehen. "Kluge Firmen behandeln das geistige Eigentum wie einen Investmentfonds: Sie managen ein gemischtes Portfolio unterschiedlicher Urheberrechte, einige geschützt, andere nicht.” Grundsätzlich sollten sie „die Wissenschaft offen und die Anwendung proprietär halten” und strategisch über "Öffnung" oder "Schließung" zu unterscheiden. Das ist längst gängige Praxis. Immer mehr Konzerne versuchen so, ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen profitabel zu machen – entweder, indem sie ihre Erkenntnisse schützen lassen und dafür Lizenzen einnehmen, oder indem sie diese Erkenntnisse veröffentlichen, um mit Hilfe der Zuarbeiter neue Produkte zu entwickeln und selbst zu vermarkten.
Deshalb sind Patente heute so wichtig wie nie zuvor. Sie sind die rechtliche Form, in der Wissen zirkulieren und seine produktive Anwendung dennoch monopolisiert bleiben kann. Noch 1990 wurden nach Zahlen des Deutschen Patentamts mit Lizenzen weltweit nur 10 Milliarden US-Dollar eingenommen. Zehn Jahre später waren es 100 Milliarden US-Dollar. Prognosen gehen für das Jahr 2010 von einer Summe von 350 bis 400 Milliarden aus. Die "Öffnung", die Tapscott und Williams beschreiben, hat zum paradoxen Ergebnis, dass immer mehr Inhalte mit Eigentumstiteln versehen werden, während sich der wissenschaftliche und Innovationsprozess beschleunigen soll.

Das Internet als Instrument der kapitalistischen Arbeitsteilung
Heute arbeiten in Deutschland 61 Prozent der Beschäftigten (zumindest zeitweise) am Computer (2003 noch 44 Prozent). Verwissenschaftlichung und Vergesellschaftung der Arbeit haben Teile des Proletariats zu "Symbolanalytikern" (Robert Reich) gemacht: Menschen, zu deren Arbeit das Entschlüsseln von Text und damit auch das Umgehen mit elektronischen Medien notwendig ist. Sie haben keinen Grund, das Produktionsmittel Internet zu glorifizieren. Ohne räumlich konzentriert zu sein, arbeiten sie zusammen, in unterschiedlichen politischen Systemen und Kulturen. Das weltweite Netzwerk verbindet nicht nur, sondern stellt sich ebenso zwischen diejenigen, die da kooperieren. Wer sitzt da auf der anderen Seite der Erde? Unter welchen Bedingungen arbeiten sie dort? Was verdienen sie? Nicht einfach, sich unter diesen Bedingungen der gemeinsamen Klassenlage bewusst zu werden.
Das Internet als Mittel der kapitalistischen Arbeitsteilung wird bisher kaum untersucht. Zum Verständnis des gegenwärtigen Kapitalismus würde das allerdings mehr beitagen als Spekulationen über die "kommunistischen Potentiale freier Software". Durch das Netz können bestimmte Branchen überhaupt erst als weltweite (Arbeits-) Märkte organisieren. Die schöne neue Ökonomie von Tapscott und Williams beruht unter anderem darauf, dass manche Menschen unentgeltlich arbeiten, während andere von ihren Löhnen nicht leben können. Vielen der "aktiven Konsumenten" kommt die Selbstbedienung entgegen, weil sie sich andere Produkte einfach nicht leisten können. Aus ihrer Perspektive handelt es sich nicht um "interaktive Wertschöpfung", sondern um einen Beitrag zur eigenen Reproduktion, um Subsistenzarbeit, die sich massenhaft verbreitet. Insofern ist Crowdsourcing auch ein Krisensymptom, Ausdruck einer postmodernen Ökonomie ohne Zukunft, und die neuen Formen der Selbstbedienung Teil des fortwährenden Drucks auf den Wert der Ware Arbeitskraft.
Literatur
Ronald H. Coase (1991) The nature of the firm. In: Oliver Williamson (Hg), The nature of the firm: Origins, evolution, and development. New York: Oxford University Press.
G. Günter Voß / Kerstin Rieder (2005) Der arbeitende Kunde. Wenn Konsumenten zu unbezahlten Mitarbeitern werden. Frankfurt: Campus.
Don Tapscott / Anthony D. Williams (2007) Wikinomics. Die Revolution im Netz. München: Hanser.